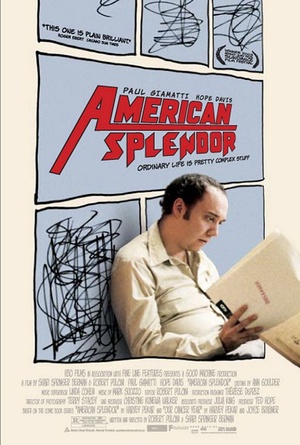American Splendor (USA 2003, Regie: Berman / Pulcini,
Buch: Harvey Pekar u. a., mit Paul Giamatti)
Manchmal kann alles ganz einfach sein. In einer Zeit,
in der spektakuläre Kinoplots den Zuschauer nicht mehr unbedingt
vom Hocker reißen, weil sie sich alle irgendwie zu wiederholen
scheinen, rückt wieder etwas Spannenderes nach vorne: Der Mensch
selbst.
Der Mensch in „American Splendor“ heißt Harvey Pekar,
und es gibt ihn wirklich. Harvey Pekar zelebriert in all seiner Ungewöhnlichkeit
das Gewöhnliche. Er ist Aktensortierer im örtlichen Krankenhaus
von Cleveland. Das ist nicht aufregend.
Als Ausgleich sammelt Harvey Jazzplatten und Comics; seine Wohnung sieht
ein bisschen so aus wie das Lager eines Entrümpelungsservices.
Das ist kein Ort der Zuflucht für Frauen, die es dementsprechend
nicht besonders lange bei Harvey aushalten. Sogar, wenn sie ihn geheiratet
haben.
Manchmal aber passieren Zufälle im Leben. Harvey trifft auf einem
Flohmarkt, wo sonst, einen netten jungen Zeichner. Einen Menschen, der
mit ihm die gleiche Wellenlinie hat. Harvey erzählt dem Zeichner
von seiner Idee, Comics über das normale Leben zu schreiben statt
über Superhelden – darüber, wie einem der Fahrradschlüssel
in den Gully fällt, oder wie man mit seiner Freundin über
das Spülen von Geschirr diskutiert.
Zeichnen kann Harvey nicht, wie seine Versuche definitiv beweisen. Aber
Harvey hat die Ideen und die Texte. 1976 veröffentlicht er zusammen
mit dem Zeichner vom Flohmarkt die erste Ausgabe seines Comics, „American
Splendor“ – ein Comic, der unspektakuläre Szenen aus
seinem eigenen Leben erzählt. Der Name des Zeichners wird bald
in aller Munde sein: Es ist Robert Crumb, heute eine Legende der Comicwelt
(z. B. „Fritz the Cat“). Auch Harvey erlangt Kultstatus,
seine Comicreihe wird Dauerläufer und berichtet bis heute aus seinem
„normalen“ Leben, mit wechselnden Zeichnern. Durch seine
Werke wird Harvey sogar endlich die Frau finden, die perfekt zu ihm
passt. Er wird in Talkshows eingeladen werden. Und schließlich
wird sogar ein Spielfilm über sein Leben produziert - dieser hier.
Die ganzen Ereignisse ändern aber nichts Grundlegendes. Harvey
Pekar bleibt so, wie er ist: Ein unverfälschter, ehrlicher Charakter,
der sich vom gesellschaftlichen Erfolg nicht beirren lässt, sondern
einfach weiter sein Leben lebt. Der weiter seine Akten sortiert und
mit den Arbeitskollegen über Gummidrops diskutiert.
„American Splendor“ ist Film, der das Gefühl unglaublicher
Authentizität verbreitet. Das ist erstaunlich, weil er ein abgeleitetes
Werk ist – zum Großteil die Verfilmung mehrerer Comics.
Die Filmautoren haben es klug angestellt: sie benutzen die Herkunft
ihrer Geschichte als Stilmittel, indem sie Sequenzen immer wieder mit
Comictexten einleiten. Darunter leidet die Glaubwürdigkeit keineswegs;
der Film schafft es vielmehr, eine zuvor noch nie gesehene Symbiose
aus Spielfilm, Comic, Dokumentation und Biographie herzustellen. Insoweit
betritt „American Splendor“ filmisches Neuland – Neuland,
das vermutlich nicht allzu oft wieder betreten wird. Weil die Konstellation,
dass der Comic einfach nur das „normale“ Leben des Comiczeichners
erzählt, ziemlich einzigartig ist.
Spannender umso mehr: Die Verquickung der Kunstformen Film, Comic und
Biographie, die im Verlauf dann sogar den realen Harvey Pekar in die
Erzählung mit einbezieht – als Gegenstück und Ergänzung
zu dem Filmcharakter Harvey Pekar – funktioniert, ohne dass man
groß darüber nachdenken muss. Eine inszenatorische Leistung,
die man nicht hoch genug würdigen kann. Trotz der ungewöhnlichen
Erzählebenen fiebert man mit Harvey Pekar, seinem Leben, seinem
Schicksal. Groß sind die Momente, wo man ihn dokumentarisch sehen
darf – als ungehobelten Letterman-Talkgast oder als alten Mann,
der die Herstellung des Films selbst reflektiert. Hier wird deutlich,
wie dicht der Film an der realen Figur des Harvey Pekar dran ist.
So wird „American Splendor“ zum Meilenstein des amerikanischen
Kinos, zum Gegenentwurf zur Bruckheimer-Welt. Selten ist es gelungen,
die Normalität derartig spannend darzustellen – und derartig
glaubwürdig. Dies ist auch Kameraführung und Produktionsdesign
(Thérèse DePrez, die sich auch für „High Fidelity“,
„Happiness“ und „Living in Oblivion“ verantwortlich
zeigte) zu verdanken. „American Splendor“ wurde für
den Oscar nominiert, gewann den Großen Preis des bedeutendsten
US-amerikanischen Filmfestivals Sundance und den Kritikerpreis in Cannes.
„American Splendor“ erzählt uns von Menschen, die wir
nicht vergessen werden. Menschen, deren Lebenseinstellungen unser eigenes
Leben bereichern werden. Und das ist es, neben allen sonstigen Vorzügen,
was den Film so bedeutsam macht.
Fazit: Der Mensch präzise beobachtet - köstlich! * * * * *
Eine Filmkritik von Stephan
Brüggenthies (www.brueggenthies.org)
Ursprünglich veröffentlicht im Kölner Stadt-Anzeiger.